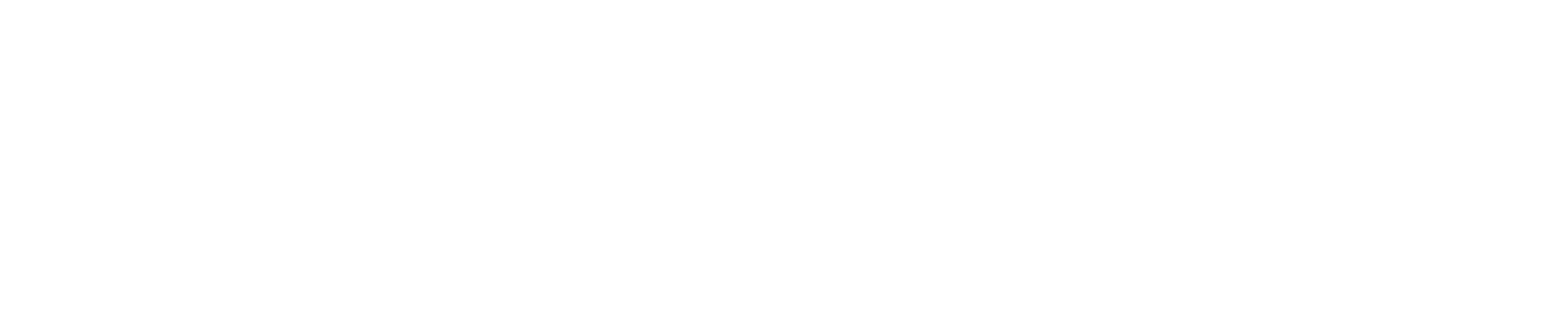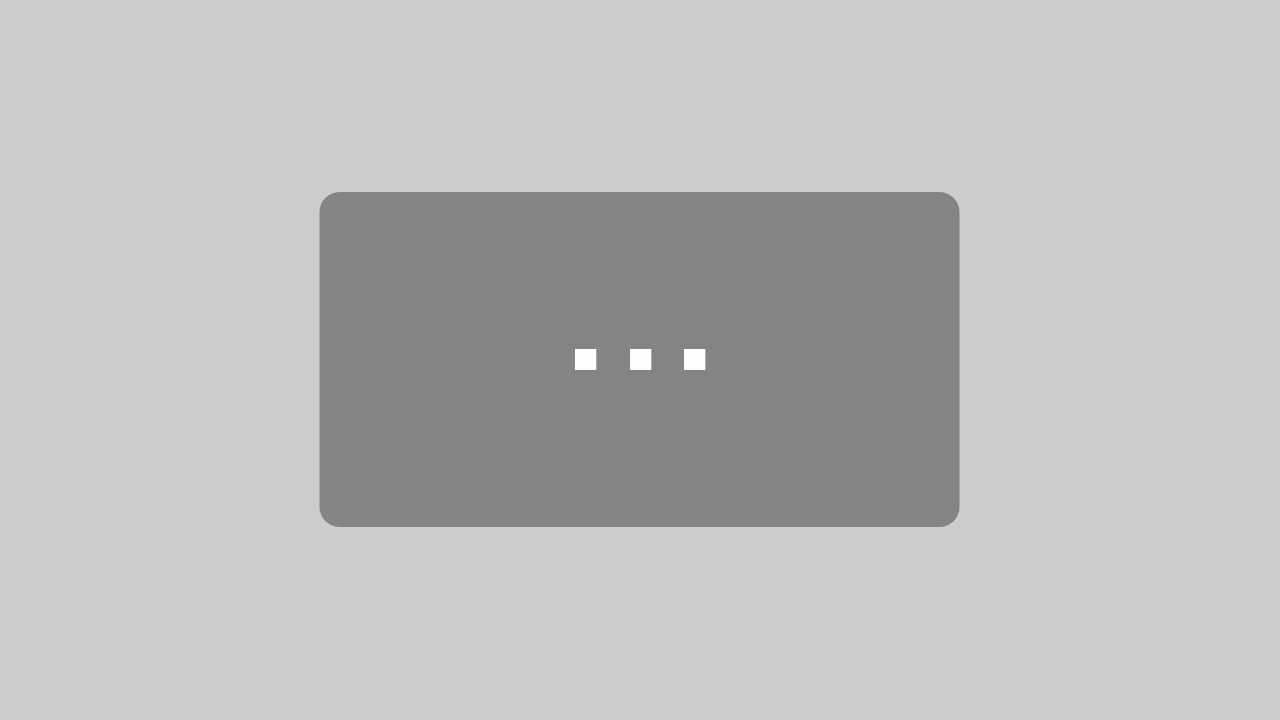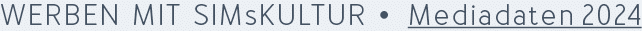Mit der Überblicksausstellung Antimatter Factory präsentiert das KunstHausWien einen umfassenden Einblick in das vielseitige Schaffen von Mika Rottenberg, darunter ihre bekanntesten Filme und Installationen aus den Jahren 2003 bis 2022, eine Auswahl kinetischer, teils interaktiver Skulpturen mit surrealen Funktions- und Materialkompositionen aus den Jahren 2020 bis 2022 sowie ihre jüngste Werkgruppe Lampshares aus dem Jahr 2024, die natürliche organische Strukturen mit farbigen Lampenschirmen aus wiederverwertetem Plastik verbindet.
Der Titel der Ausstellung, Antimatter Factory, zitiert den Namen einer Forschungsabteilung am CERN in Genf, die Experimente zur Antimaterie durchführt. Rottenberg fand dort als Artist in Residence Inspiration für ihre Arbeit Spaghetti Blockchain (2019–2024), die den Austausch von Energien, Objekten und Menschen zum Thema hat. Mika Rottenberg erschafft Fantasiewelten von verführerischer Sinnlichkeit und irritierender Logik. Aus einer augenzwinkernden marxistischen Perspektive und mit Blick auf den menschlichen Körper untersucht sie kapitalistische Produktionsbedingungen und den Wert von Arbeit. Von einer Perlenzucht über einen chinesischen Großmarkt für Billigwaren bis hin zur Herstellung von Fertiggerichten: Rottenbergs Arbeiten decken die grotesken Mechanismen globaler Lieferketten, industrieller Fertigung und profitorientierter Arbeit auf und zeigen die skrupellose Ausbeutung von Menschen und Ressourcen. Mit absurdentwaffnendem Humor beleuchtet die Künstlerin die zunehmende Entfremdung in einer hyperkapitalistischen Welt und mahnt die Dringlichkeit eines Ausstiegs aus diesen Strukturen an.
Gerlinde Riedl, Direktorin KunstHausWien:
„Soziale und ökologische Ausbeutung, Überproduktion und Ressourcenverschwendung: Während die Resignation in der Gesellschaft im Angesicht der globalen Herausforderungen zunimmt, begegnet Mika Rottenberg den großen Themen unserer Zeit mit einem provokanten Augenzwinkern. Es ist Kunst wie diese, die uns durch ihren Perspektivenwechsel die Sinnlosigkeit des weltweiten Konsums schonungslos vor Augen führt und deren Absurdität und Unlogik zugleich etwas äußerst Befreiendes hat.“

Mika Rottenberg, Courtesy the artist and Hauser & Wirth Photo: Pete Mauney
Die Befragung der Grenzen zwischen Realität und Fiktion zieht sich wie ein roter Faden durch Rottenbergs filmische Installationen. Menschen und Dinge scheinen in Bewegung zu geraten, Raum und Zeit, Vergangenheit und Zukunft scheinen sich zu vermischen. In Rottenbergs Filmen verrichten die Menschen die verschiedensten Tätigkeiten: Sie niesen Steaks, Kaninchen, Glühbirnen oder ganze Mahlzeiten auf Tische und Teller; sie befeuchten Haare, Füße oder Hintern; sie sitzen inmitten von Plastikwaren oder glitzernden Girlanden, auf Kundschaft wartend. Rottenbergs vielschichtiges Werk kann als Spiegel unserer globalisierten Zeit verstanden werden, „in denen nichts mehr verschwindet, sondern alles infolge einer frenetischen Archivierung angehäuft wird.“ (Nicolas Bourriaud, Radikant, 2009)
In Rottenbergs Werk ist menschliche Arbeit der Motor eines ungebremsten Wachstums, das Mensch und Natur gleichermaßen ausbeutet. Ihr sozialer Surrealismus offeriert einen veränderten Blick auf die komplexen Stoffwechsel unserer Zeit. Die Werke scheinen keine räumlichen Orientierungspunkte wie oben und unten, innen und außen zu kennen, und fangen so die widersprüchliche Natur des 21. Jahrhunderts ein, das von globalen Lieferketten, Digitalisierung und ökologischen Umwälzungen geprägt ist.
Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Museum Tinguely in Basel und den Lehmbruck Museum in Duisburg.
Mika Rottenberg (*1976) ist eine in New York lebende Künstlerin, die in ihrer Praxis Film, architektonische Installationen und interaktive kinetische Objekte kombiniert, um die Absurdität der ausufernden Warenproduktion in unserer heutigen hyperkapitalistischen Welt zu veranschaulichen. Von der Perlen- und Lebensmittelzucht bis hin zur Massenproduktion von Plastikartikeln in China, verweist Rottenberg auf humorvolle Weise auf die Dringlichkeit, Ressourcen zu schonen, weniger zu konsumieren und nachhaltiger zu leben.
Mika Rottenberg wurde 1976 in Buenos Aires geboren und wuchs in Israel auf; im Jahr 2000 zog sie in die USA. Sie studierte an der School of Visual Arts sowie an der Columbia University in New York. Rottenberg wurde 2019 mit dem Kurt Schwitters Preis und 2018 mit dem James Dicke Contemporary Artist Prize des Smithsonian American Art Museum ausgezeichnet. Das Werk der Künstlerin wurde in den letzten Jahren in einer Reihe von Einzelausstellungen international präsentiert, unter anderem im Musée d’art contemporain de Montréal (2022), Louisiana Museum of Modern Art (2021), Museum of Contemporary Art Toronto (2020), Sprengel Museum Hannover (2020), Museum of Contemporary Art Chicago (2019), Kunsthaus Bregenz (2018) und Palais de Tokyo (2016). Mika Rottenberg lebt und arbeitet in New York.
27. Februar bis 10. August 2025
www.kunsthauswien.com

Mika Rottenberg, Courtesy the artist and Hauser & Wirth